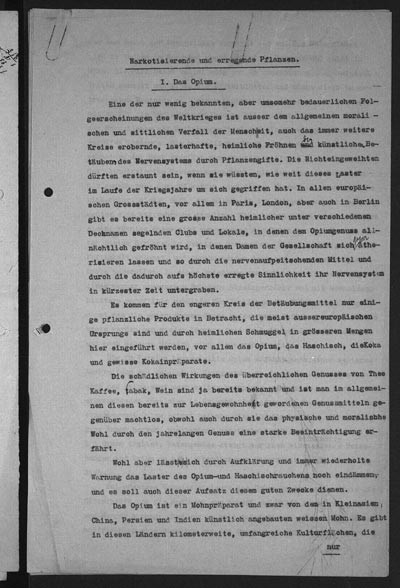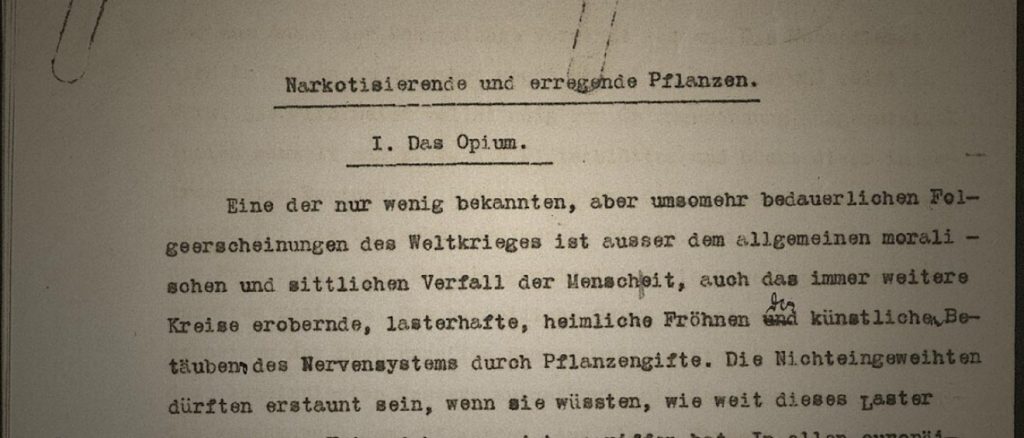Narkotisierende und Erregende Pflanzen
Anmerkung von Volker Lechler:
[Der nun folgende, im Original handschriftliche Aufsatz wurde, wie aus dem Zusammenhang zu entnehmen ist, von Eugen Grosche verfasst. Die im Text kleiner geschriebenen Stellen sollen verdeutlichen, dass Grosche hier Korrekturen eingefügt hat. Ich habe den Satzumbruch bewusst so belassen, damit die Authentizität nicht verfälscht wird. Auf eine Besonderheit möchte ich hinweisen: Bei mehreren der Texte stellte Eugen Grosche einen „Dr.“ vor seinen Namen, obwohl er nicht promoviert hatte.]
Narkotisierende und erregende Pflanzen.
I. Das Opium.
Eine der nur wenig bekannten, aber um so mehr bedauerlichen Folgeerscheinungen des Weltkrieges ist ausser dem allgemeinen moralischen und sittlichen Verfall der Menschheit, auch das immer weitere Kreise erobernde, lasterhafte, heimliche Frönen des künstlichen Betäubens des Nervensystems durch Pflanzengifte. Die Nichteingeweihten dürften erstaunt sein, wenn sie wüssten, wie weit dieses Laster im Laufe der Kriegsjahre um sich gegriffen hat. In allen europäischen Grosstädten, vor allem in Paris, London, aber auch in Berlin gibt es bereits eine grosse Anzahl heimlicher, unter verschiedenen Decknamen segelnden Clubs und Lokale, in denen dem Opiumgenuss allnächtlich gefrönt wird, in denen Damen der Gesellschaft sich sogar ätherisieren lassen und so durch die nervenaufpeitschenden Mittel und durch die dadurch aufs höchste erregte Sinnlichkeit ihr Nervensystem in kürzester Zeit untergraben.
Es kommen für den engeren Kreis der Betäubungsmittel nur einige pflanzliche Produkte in Betracht, die meist aussereuropäischen Ursprungs sind und durch heimlichen Schmuggel in grösseren Mengen hier eingeführt werden, vor allem das Opium, das Haschisch, die Koka und gewisse Kokainpräparate.
Die schädlichen Wirkungen des überreichlichen Genusses von Tee, Kaffee, Tabak, Wein sind ja bereits bekannt und ist man im allgemeinen diesen bereits zur Lebensgewohnheit gewordenen Genussmitteln gegenüber machtlos, obwohl auch durch sie das physische und moralische Wohl durch den jahrelangen Genuss eine starke Beeinträchtigung erfährt.
Wohl aber lässt sich durch Aufklärung und immer wiederholte Warnung das Laster des Opium- und Haschischrauchens noch eindämmen, und es soll auch dieser Aufsatz diesem guten Zwecke dienen.
Das Opium ist ein Mohnpräparat und zwar von dem in Kleinasien, China, Persien und Indien künstlich angebauten weissen Mohn. Es gibt in diesen Ländern kilometerweite, umfangreiche Kulturflächen, die nur zum Anbau der Mohnpflanze verwandt werden. Die Mohnpflanze wird in Indien im November gesät, blüht im Februar und reift im März. Sie wird meist vollständig zur Opiumgewinnung ausgenutzt. In Indien sammelt man z. B. die Blütenblätter und bäckt diese in getrocknetem Zustande zu kleinen Kuchen, die ein begehrtes Genussmittel für die indische Bevölkerung bilden. Der wirksamste Teil der Mohnpflanze als Betäubungsmittel ist die Samenkapsel in noch unreifem Zustande. Das eigentliche Opium selbst wird durch Anschneiden der noch unreifen Samenkapsel mittelst eines besonders dazu konstruierten Messers ausgeführt, mit dem Längsschnitte in die Samenkapsel gemacht werden. Aus diesen Einschnitten quillt ein blassroter, dicker Saft, der Milchsaft der Mohnpflanze, von dem sich später eine kaffeebraune dickliche Flüssigkeit absetzt. Die erstere dicke, körnige Masse wird nun während der Dauer von 3 – 4 Wochen unter stetem Umrühren im Schatten getrocknet, bis sie eine gewisse Festigkeit erlangt, und daraus werden dann die sogenannten Opiumbrote zubereitet. In einer Unterlage von Mohnblumenblättern wird diese vorher abgewogene Substanz hineingedrückt und mit Mohnblumenblättern sorgfältig umhüllt. Zum Verkleben der Blätterumhüllung nimmt man die schon oben erwähnte kaffeebraune Saftabsonderung. Diese Brote werden nun wieder längere Zeit in Luft und Sonne getrocknet und nach mehreren Monaten sind sie versandfertig.
Das in Persien hergestellte Opium erfährt noch eine weitere Bearbeitung und gelangt in Stangenform in den Handel. Zum Rauchen wird das Opium erst noch weiter besonders zubereitet und wird in erbsengrossen Kügelchen in Opiumpfeifen geraucht. Das in fester Form eingenommene Opium bringt beinahe dieselbe Wirkung wie der eingezogene Rauch hervor. Man beginnt meistenteils mit dem Rauchen von 1 bis 1 ½ Gramm täglich. Naturgemäss steigt der sich einstellende krankhafte Heisshunger auf Opium zu weit erheblicherem Bedarf bis zu 100 Gramm täglich.
Bei mässigem Genuss steigert das Opium in der ersten Zeit die Körperkraft und die Ausdauer zur Arbeit und hilft leicht über Durst und Hunger hinweg; aber nur zu bald folgt dieser scheinbaren Körperauffrischung eine Reaktion und der Organismus wird schnell ruiniert. Die Wirkungen des Opiumrauchens sind ungefähr folgende: Der Raucher versinkt in süsse Träume, meist sinnlichen Inhalts, er dünkt sich sehr oft gleichsam körperlos und alle seine Wünsche gehen in diesem künstlichen Traumleben in Erfüllung. Beim Erwachen jedoch zeigen sich Nachwehen, die den sogenannten Katzenjammer bei weitem übertreffen: starker Schwindel, Kopfschmerz, grosse körperliche Mattigkeit und ein allgemeines übles Befinden. Später stellen sich Schmerzen in den Knochen und Muskeln ein und eine Schädigung der Darmorgane. Im noch späteren Stadium werden die Augen des Gewohnheitsrauchers glanzlos und trübe, der Kopfschmerz wird permanent, die Zunge stark belegt, Augen und Nase triefen und die Verdauung wird ganz erheblich gestört. In späterer Folge tritt dann schnelle Abmagerung ein, starke Atmungsbeschwerden und schliesslich der Tod. Durch immer verstärkte Inanspruchnahme des Giftes werden natürlich diese Folgeerscheinungen jahrelang hinausgeschoben, aber die Katastrophe für den Gesamtorganismus tritt dann um so wuchtiger und entgültiger ein. Eine zu spät angefangene Entziehungskur ist meistenteils für die Unglücklichen wirkungslos, denn sie verfallen sehr oft dann in Raserei und Tobsucht, wenn sie das Genussmittel, an das sich ihr Körper gewöhnt hat, nicht mehr bekommen. Es gibt viele Menschen, die aus Neugierde und Leichtsinn das Opiumrauchen probieren und nach und nach diesem Laster doch in die Arme geraten.
Besonders in den besseren Kreisen der hiesigen Gesellschaft wird dem Opiumrauchen gefrönt. In den aussereuropäischen Ländern ist es dagegen zum allgemeinen Volkslaster geworden. Es gibt das nicht nur in jeder Stadt, sondern auch in jedem Flecken, sogenannte Opiumhäuser, die meist zugleich auch Bordelle sind. England hat durch den Opiumzoll eine Einnahme, die man auf 20 Millionen Pfund Sterling jährlich schätzt.
II. Das Haschisch
Eine ähnliche Rolle wie das Opium in der Art seiner Wirkung spielt das Haschisch in Ostindien, Mittelafrika, speziell in Ägypten. Es ist eine Hanfart, besonders der indische Hanf (Cannabes indica), die zur Herstellung des Haschisch verwendet wird.
Gleich nach dem Blühen der Hanfpflanze wird das in den Haardrüsen der Blätter und Stiele in Menge aufgespeicherte zähflüssige Harz (Churrus) abgeschabt und gesammelt. Ein jedes Haardrüschen der Pflanze enthält dieses Sekret, das bei Verletzungen sofort austritt, da es in sehr grosser Menge in den verdickten Köpfen der Haardrüse vorhanden ist. Ausser dem Harz (Churrus) werden auch die jungen, mit Blüten, Früchten und kleinen Blättern besetzten Teile des Hanfes getrocknet, zerrieben und in pulverisiertem Zustand als Berauschungsmittel verwandt. Das beste Haschisch wird in Indien gewonnen aus reinen Hanf-Harzpräparaten. Der gepulverte Hanf ist mehr in Arabien und Ägypten üblich und kommt dort unter dem Namen Keef in den Handel. Das Haschisch wird ebenso geraucht wie das Opium, doch gibt es noch viele verschiedenartige Zubereitungen und Extrakte. Man geniesst es in Form kleiner Kuchen, Pillen, Pastillen, als Konfitüren vermischt mit Zucker und anderen Süssigkeiten. Auch zu einer Art Teeaufguss werden die jungen Hanfblätter verwandt.
Der Haschischgenuss ist in der gesamten Türkei, Arabien, Persien, Kleinasien, Indien, bis nach Südafrika verbreitet und 300 – 400 Millionen Menschen frönen diesem Genuss mehr oder weniger.
Wenn auch der Haschischgenuss nicht so krass schädliche Wirkungen wie das Opium im menschlichen Körper zurücklässt, so zeitigt er doch bei andauerndem Genuss durch Jahre hindurch ein frühzeitiges Welken des gesamten körperlichen Organismuses, bedingt vor allem ein frühzeitiges Abstumpfen der Nerven durch das fortwährende Überreizen, sodass in späteren Stadien bei gewohnheitsmässigen Rauchern oder Haschischessern, wie beim Opium Nervenkrämpfe, Delirien und schwere Verdauungsschwierigkeiten entstehen.
Die bei Fremden im Orient so oft ungemein sympatisch berührende Sorglosigkeit und Leichtlebigkeit des Orientalen beruht sehr oft auf dem geheimen Haschischgenuss. In den Harems und Kaffeehäusern des Orients ist das Haschischrauchen natürlich gang und gebe, und zum volkstümlichen Laster geworden.
III. Der Betel. Die Koka.
Schon von alters her waren diese beiden Pflanzen als Betäubungsmittel der Nerven bekannt, da das Kauen von Blättern derselben das Nervensystem des Körpers in einen erregten Zustand versetzt.
Das Betelkauen ist vor allem allen südasiatischen Volksstämmen eigen. Besonders die malayischen Einwohner sind sehr dem Betelgenuss verfallen. Das Blatt der Betelpflanze (Piper Betle L.) und das ähnliche Blatt des Malimiri Pfeffers wird nur in Verbindung mit der Arekanuss und Ätzkalk gebraucht. Der längere Genuss des Betels hat eine angenehme Auffrischung der Nerven zur Folge, das Allgemeinbefinden des Menschen wird besser und die Nerven werden widerstandsfähiger. Bei längerem Gebrauch des Betels werden die Zähne schwarz, die Lippen und das Zahnfleisch dunkelrot und nach und nach treten schwere Verdauungsstörungen ein, die starke Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und Heisshunger nach sich ziehen. Die Haut wird fahl und bleifarben, später kommt Wassersucht, Gelbsucht und Gliederschwellungen hinzu, die dann mit einer allgemeinen Auszehrung enden.
Die Betelpflanze wird in allen indischen Ländern angebaut, auch in China und auf den australischen Inseln.
Die Arekanuss stammt von der auf den australischen Inseln und auf Ceylon einheimischen Arekapalme (Areca Catechu L.) und ist ein wichtiger Handelsartikel dieser Länder. Die Arekanuss wird nach Entfernung der äusseren Schale in Stücke zerschnitten und in die Blätter des Betelpfeffers, die auf der Innenseite mit Kalk ausgebrannten Muscheln oder Korallen bestrichen sind, eingewickelt und so kleine fingerdicke Röllchen zu dem Kaugebrauch hergestellt. Die gesamte Bevölkerung huldigt dem Betelkauen, ganz gleich ob Kind, Mann oder Weib, ob alt oder jung.
Auch ähnliche schädliche Wirkungen, wie der längere Genuss des Betels bringt auch der Gebrauch der Koka nach sich.
Der Kokastrauch (Erythrexylum Coca Lam.) wächst in den Cordellieren, am häufigsten in Peru und Bolivien. Auch in Ebenen des Amazonasstromes wird er in grossen Plantagen angebaut. Da die Blätter schon nach einem Jahre ihre berauschende Wirkung auf den Organismus verlieren, können sie nicht ausgeführt werden. Man findet deshalb das Kokakauen nur in Südamerika verbreitet. Auch wie beim Betelpfeffer ist der mässige anfängliche Genuss der Koka erfrischend, wird aber durch die täglich zunehmende Gewohnheit ein Laster, der das Lebensalter des Menschen erheblich verkürzt. Kein Betel- oder Kokakauer wird in der Regel älter als 55 Jahre.